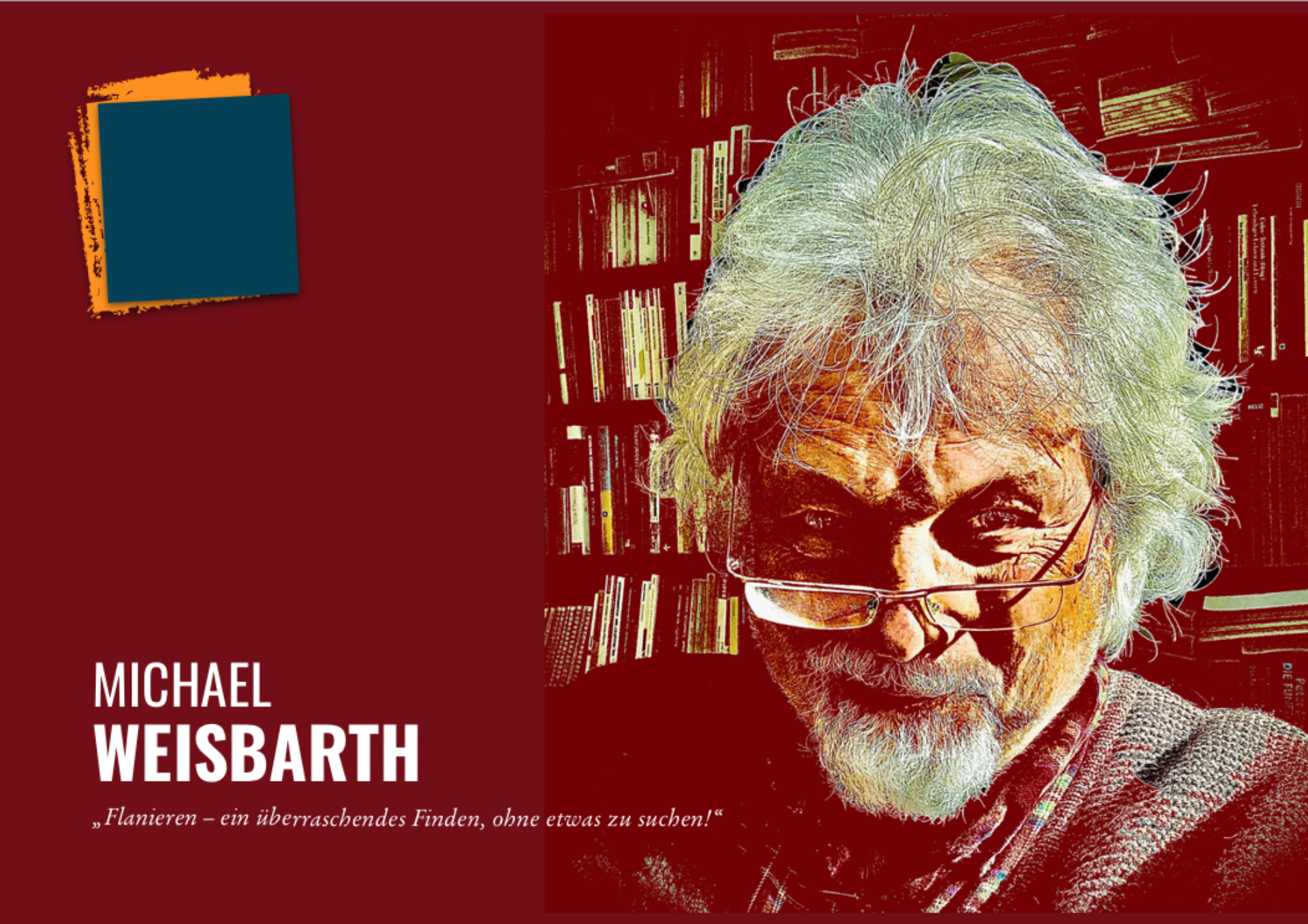Wie soll es weitergehen? Wozu ist diese Corona-Zäsur gut? Wenn ich mir darüber Gedanken mache, dann komme ich zu guter Letzt (das ist ein alter Ausdruck für „ganz zum Schluß“) immer wieder auf die Begriffe Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit. Warum? Weil das Nachdenken darüber, wie ein soziales Zusammenleben anders, besser organisiert werden kann, mich immer in eine scheinbare argumentative Sackgasse führt. Spätestens bei der Frage, warum jemand etwas tun soll, was seinen Interessen zu widersprechen scheint, zerbricht das schöne Gedankenexperiment. Warum sollte jemand sich beschränken, freiwillig auch noch, um anderen etwas zu ermöglichen? Wenn ich an diesem Punkt bin, denke ich immer an die Beschreibung des Verhältnisses von Individuum und Kollektiv, die Adorno einmal sinngemäß so formulierte: Wahre Kollektivität lässt sich nur als entwickelte Individualität denken, denn nur ein entwickeltes Individuum ist in der Lage, die Interessen eines Kollektivs freiwillig über die Verfolgung der Eigeninteressen zu stellen. Für ein Kollektiv somit eine existenzielle Voraussetzung.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es eine der vornehmsten Eigenschaften eines Individuums, etwas nicht zu tun, obwohl es nicht verboten ist. Vorausgesetzt, jemand ist dazu in der Lage (können), es ist erlaubt (dürfen), und der Wille ist vorhanden (wollen). Etwas dann trotzdem nicht zu tun, ist eine ethische Haltung, die über den individuellen Lebenskontext hinausweist, und das Ganze der Gesellschaft im Blick hat. Notabene die Haltung eines Individuums.
Die Erkenntnis heißt, dass ich meine Freiheit begrenzen muss, weil ich akzeptierte, dass andere Menschen grundsätzlich den gleichen Anspruch auf ihre Freiheit haben. Das gilt universell. Es ist für alle Menschen der gleiche Anspruch. Daran ist zu erkennen, dass Gleichheit (Gleichwertigkeit) und Freiheit immer zusammen gedacht werden müssen, sie beeinflussen sich gegenseitig, begrenzen sich. Sie stehen in einem dialektischen Verhältnis zueinander.
Wenn jetzt noch der Begriff Gerechtigkeit hinzukommt, und das muss er, dann wird dieses Gedankenexperiment erst wirklich schwierig. Handwerkszeug für Philosoph*innen und andere Kopfarbeiter*innen, unüberwindbare Abstraktionshürden für den Rest der Welt. Trotzdem aber notwendig, wenn wir uns gemeinsam weiter entwickeln wollen.
Gerechtigkeit also ist hier mitzudenken, weil sie für die Entscheidung, etwas nicht zu tun, obwohl es nicht verboten ist, essentiell ist. Wenn ich etwas als gerecht empfinde, fällt es mir weniger schwer, mich einzuschränken. Deshalb müssen wir unbedingt über Gerechtigkeit sprechen. Der Begriff Gerechtigkeit meint zunächst, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Eine Gesellschaft ist gerecht, wenn sie den Individuen gerechtes Handeln ermöglicht. Immanuel Kant hat das in einen „Kategorischen Imperativ“ gegossen, der das eigene Handeln immer an der Frage orientiert, ob es auch zu einem allgemeinen Gesetz tauge. Das bezieht sich auf das menschliche Zusammenleben. Eine Erweiterung zur „sozialen Gerechtigkeit“ erfährt der Begriff durch die Konsequenzen unserer Ökonomie, die den meisten Menschen die Teilhabe an der Gesellschaft unmöglich macht, weil die dafür notwendigen Voraussetzungen fehlen, seien es materielle, intellektuelle, oder soziale. Soziale Gerechtigkeit verweist auf die Aufgabe des Staates, diese Voraussetzungen für alle Menschen zu gewährleisten, die Erfüllung dieser Aufgabe lässt sich nur universell denken.
Diese Begriffe, die als politische Forderung den Slogan der Französischen Revolution 1789 („Liberté, Égalité, Fraternité“) ausmachten, werden in unterschiedlichen Diskussionen gegeneinander ausgespielt, im Sinne von entweder das eine, oder das andere. Oder sie sind im bewußtlosen Geplapper in den sozialen Netzwerken zu Phrasen geronnen, die mit Mühe noch ahnen lassen, welch’ ehrwürdige Bedeutung sie einst hatten. Gleichwohl, es sind die Begriffe, über die es nachzudenken und zu sprechen gilt, wenn die „künftige Normalität“ anders sein soll, als die „alte Normalität“. Wenn Max Horkheimer recht hatte mit der Aussage über dieses Dilemma: „Je mehr Gerechtigkeit, desto weniger Freiheit, je mehr Freiheit, desto weniger Gerechtigkeit“, dann sei damit nachdrücklich angemahnt, darüber ständig im Gespräch zu bleiben, immer wieder neu sich abzustimmen, zu akzeptieren, dass sich Rahmenbedingungen verändern können, wissenschaftliche Erkenntnisse einen neuen Blickwinkel nötig machen, technische Entwicklungen neue Perspektiven eröffnen, die wiederum neue Bewertungen nötig machen.
All das macht mir klar, dass wir nicht nur über Begriffe wie Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und ihre dialektische Verwobenheit sprechen müssen. Vor allem müssen wir miteinander sprechen! Und zwar in einer Sprache, die dem Gegenstand angemessen ist, das heißt vor allem ernsthaft, konzentriert, jenseits vom bloßen Aneinanderreihen von Meinungen und Klischees. Also mit Argumenten. Und mit der Unterstützung derjenigen, die genau damit Erfahrung haben. Weil wir sonst auch immer für jeden Mist Fachleute holen! Dieses Miteinander-Reden ist eine Kunst, in der wir uns immer wieder üben müssen, davon bin ich überzeugt. Altbekannte Verhaltensweisen, etwas derangiert und aus der Mode gekommen, und als Deko sogenannter Sonntagsreden zurechtgestutzt, können uns dabei helfen: großzügig, demütig, nachsichtig, humorvoll, geduldig, zuversichtlich, – bei Hans-Dieter Hüsch sind sie, wie so oft, in unnachahmlicher Weise zu Poesie geworden:
„Bedenkt, dass jetzt um diese Zeit, der Mond die Stadt erreicht. Für eine kleine Ewigkeit sein Milchgesicht uns zeigt. Bedenkt, dass hinter ihm ein Himmel ist,
den man nicht definieren kann.
Vielleicht kommt jetzt um diese Zeit
ein Mensch dort oben an.
Und umgekehrt wird jetzt vielleicht
ein Träumer in die Welt gesetzt.
Und manche Mutter hat erfahren,
dass ihre Kinder nicht die besten waren.
Bedenkt auch, dass ihr Wasser habt und Brot,
dass Unglück auf der Straße droht,
für die, die weder Tisch noch Stühle haben
und mit der Not die Tugend auch begraben. Bedenkt, dass mancher sich betrinkt,
weil ihm das Leben nicht gelingt,
dass mancher lacht, weil er nicht weinen kann.Dem einen sieht man’s an, dem andern nicht.
Bedenkt, wie schnell man oft ein Urteil spricht.
Und dass gefoltert wird, das sollt ihr auch bedenken. Gewiss, ein heißes Eisen, ich wollte niemand kränken, doch werden Bajonette jetzt gezählt und wenn eins fehlt, es könnte einen Menschen retten,
der jetzt um diese Zeit in eurer Mitte sitzt,
von Gleichgesinnten noch geschützt.
Wenn ihr dies alles wollt bedenken,
dann will ich gern den Hut,
den ich nicht habe, schwenken.
Die Frage ist, die Frage ist,
sollen wir sie lieben, diese Welt?
Sollen wir sie lieben?
Ich möchte sagen, wir wollen es üben.“
Ein Essay zum Thema „Freiheit und Gleichheit“ von Ulrike Ackermann, obwohl aus 2013 immer noch aktuell.